|

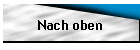
Home
Übersicht

| |
|
Unterhaltspflicht
Bedürftigkeit
Betreuung
Alter
Ausbildung
|
 |
| Nachehelicher
Unterhalt kann es wegen der Betreuung von Kindern, wegen Alter oder Krankheit, als Erwerbslosen- oder
Aufstockungsunterhalt sowie als Ausbildungsunterhalt oder aus
Billigkeitsgründen geben.
|
Das
sagt das Gesetz in § 1577 BGB:
(1) Der geschiedene Ehegatte kann den
Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen,
solange und soweit er sich aus seinen Einkünften und seinem Vermögen
selbst unterhalten kann.
(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den
vollen Unterhalt (§ 1578) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt
übersteigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung
der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit
entspricht.
(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu verwerten,
soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der
beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.
(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unterhalt des
Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein würde, fällt
das Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch auf Unterhalt.
Dies gilt nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem
Ehegatten wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes
eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.
|
|
Kann der ehemalige Ehegatte Unterhalt verlangen, weil er durch die
Betreuung von Kindern nicht (mehr) arbeiten kann? Ist er zu alt oder zu
schwach? Will er noch eine Ausbildung abschließen oder sucht er nach
einer Arbeit? Waren die Eheverhältnisse früher so gut, dass ein
Aufstockungsunterhalt in Betracht kommt, damit der Ehegatte wenigstens
ökonomisch wieder so gestellt ist wie zuvor?
Nach der Scheidung besteht jedenfalls eine verstärkte
Erwerbsobliegenheit, d.h. der Ehegatte muss sich nachhaltig um eine Arbeit
kümmern, sonst kann ihm ein fiktives Einkommen zugerechnet werden. Das Maß des Unterhalts
bestimmt sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Die Bemessung des
Unterhaltsanspruchs nach den ehelichen Lebensverhältnissen kann zeitlich
begrenzt und danach auf den angemessenen Lebensbedarf abgestellt werden,
soweit insbesondere unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe sowie der
Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit eine zeitlich
unbegrenzte Bemessung unbillig wäre; dies gilt in der Regel
nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorübergehend ein
gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend betreut hat oder betreut.
Die Zeit der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich. Der Unterhalt
umfasst den gesamten Lebensbedarf.
|
| BGH 2010: Ist
der Unterhaltsberechtigte vollständig an einer
Erwerbstätigkeit gehindert, ergibt sich nach dem BGH der
Anspruch auf nachehelichen Unterhalt allein aus den §§ 1570 bis 1572
BGB, und zwar auch für den Teil des Unterhaltsbedarfs, der nicht auf dem
Erwerbshindernis, sondern auf dem den angemessenen Lebensbedarf übersteigenden
Bedarf nach den ehelichen Lebensverhältnissen gemäß § 1578 Abs. 1 Satz
1 BGB beruht. Ist der Unterhaltsberechtigte hingegen nur teilweise
an einer Erwerbstätigkeit gehindert, ergibt sich der
Unterhaltsanspruch wegen des allein durch die Erwerbshinderung
verursachten Einkommensausfalls aus den §§ 1570 bis 1572 BGB und im Übrigen
als Aufstockungsunterhalt aus § 1573 Abs. 2 BGB. |
| Das OLG Celle
hat 2010 entschieden, dass eine 44jährige geschiedene Ehefrau eines
Zahnarztes vier Jahre nach Rechtskraft der Scheidung auch dann auf den
Arbeitsmarkt für un- und angelernte Kräfte verwiesen werden kann, wenn
sie das Abitur erworben und ein Lehramtsstudium im Zusammenhang mit der
Eheschließung abgebrochen hat. Das gilt jedenfalls dann, wenn sie während
der Ehezeit mehrere Jahre als ungelernte Empfangskraft in der Praxis des
Ehemannes mitgearbeitet hat. |
| Ältere
Rechtsprechung etwa OLG Hamm im Jahre 1991 - 12 UF 210/90 zur
Erwerbsobliegenheit und zum fiktiven Einkommen: Auch bei einer langjährigen Ehe,
die in diesem Fall fast zwanzig Jahre dauerte nebst einem erwachsenen Kind mit einem selbständigen Zahnarzt ist der rund vierzigjährigen
Ehefrau nach einer Trennungszeit von fast zwei Jahren die Aufnahme einer
vollschichtigen Tätigkeit in ihrem erlernten Beruf (hier Arzthelferin mit
umfangreicher Berufserfahrung in der Krankenpflege bis etwa acht Jahre vor
der Scheidung) zumutbar.
Ist die Ehefrau dieser Obliegenheit nicht oder nicht ausreichend
nachgekommen (hier Tätigkeit außerhalb des erlernten Berufes mit
geringerer Entlohnung) so kann bei der Berechnung des nachehelichen
Unterhaltes von dem Einkommen ausgegangen werden, das sie bei einer Tätigkeit
im erlernten Beruf erzielen könnte.
>> War die Ehefrau in den letzten Jahren des Zusammenlebens nicht mehr
berufstätig, so haben die in den Jahren davor bezogenen Einkünfte die
ehelichen Lebensverhältnisse nicht mehr geprägt. Das (fiktive) Einkommen
ist daher im Wege der Anrechnungsmethode zu berücksichtigen.
>> Eine zeitliche Begrenzung des Ehegattenunterhalts nach § 1573 Abs.
5 BGB kommt im Hinblick auf die Ehedauer und die Tatsache nicht in Frage,
dass die Ehefrau während der siebenjährigen Ausbildung des Ehemannes zum
Zahnarzt nicht unbeträchtliche Opfer in der Lebensführung hingenommen
hat.
Bei der Bemessung des nachehelichen Unterhaltes nach den ehelichen
Lebensbedingungen, § 1578 Abs. 1 BGB, ist ein objektiver Maßstab
anzulegen. Eine nach den Verhältnissen zu dürftige Lebensführung bleibt
ebenso außer Betracht wie ein übertriebener Aufwand. Auch die Verwendung von Teilen des Einkommens zur Vermögensbildung
ist unterhaltsrechtlich nur soweit beachtlich, als es vom Standpunkt eines
vernünftigen Beobachters angemessen ist (hier keine Berücksichtigung der
Vermögensbildung bei einem monatlichen Nettoeinkommen des Pflichtigen von
8.333 DM).
Dienen Lebensversicherungen eines Selbständigen nicht der
Altersvorsorge sondern der Tilgung von Darlehen, die zur
Praxisfinanzierung aufgenommen wurden, so sind sie nicht vor der
Berechnung des Ehegattenunterhalts vom Einkommen abzuziehen, wenn schon
die Abschreibungen der finanzierten Einrichtungsgegenstände in den
Einnahme-Überschussrechnungen berücksichtigt sind.
|
| Auch sehr
weitgehend vgl. OLG Köln vom 21. Januar 1992
- 4 UF 170/91 zur
Erwerbsobliegenheit und zum fiktiven Einkommen: Eine
im Zeitpunkt der Trennung der Parteien nicht berufstätige und 52 Jahre
alte Ehefrau muss sich spätestens
ein halbes Jahr nach der Trennung intensiv
und nachhaltig um eine vollschichtige Arbeitsstelle bemühen. Das reicht
soweit, dass sie ggfs. auch auf eine angemessene berufsfremde Tätigkeit
zurückgreifen müsste.
Sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass es ihr auch bei dem
gebotenen Einsatz nicht möglich gewesen wäre, eine vollschichtige Arbeit
zu finden, muss sie sich ein fiktives Eigeneinkommen anrechnen lassen, bei
dem allerdings zu berücksichtigen ist, dass sie sich - bei einem
Wiedereinstieg in das Erwerbsleben nach langer Unterbrechung - uU zunächst
mit einem vergleichsweise niedrigen Gehalt hätte abfinden müssen. |
| Wird
der Unterhalt in solchen nachehelichen Fällen irgendwann befristet?
Dazu hier auf der folgenden Seite
>> |
| Beispiel BGH
(19. Februar 1986 - IVb ZR 13/85): Kapitalerträge
mindern in der Höhe, in der sie dem geschiedenen Ehegatten zufließen,
dessen Bedürftigkeit; ein Abzug zum Ausgleich eines inflationsbedingten
Wertverlustes des Vermögensstammes kommt nicht in Betracht. |
| Wie
aber sieht das bei getrennt lebenden Ehegatten aus?
Die Obliegenheit eines getrennt lebenden Ehegatten, zur
Deckung seines Unterhaltsbedarfs den Stamm seines Vermögens einzusetzen,
geht im allgemeinen nicht so weit wie diejenige eines Geschiedenen gemäß
BGB § 1577 Abs. 3 (Vgl. die exemplarische Entscheidung: BGH vom 16. Januar
1985
- IVb ZR 60/83). Der Anspruch auf Trennungsunterhalt besteht nur, soweit
ein Ehegatte außerstande ist, für seinen angemessenen Unterhalt zu
sorgen. Er setzt also Bedürftigkeit
voraus. Bedürftigkeit wird allgemein
nicht nur durch Erwerbseinkommen oder Vermögenserträge ausgeschlossen,
sondern sie besteht im Grundsatz auch dann nicht, wenn der Anspruchsteller
seinen Unterhalt aus dem Stamme seines Vermögens bestreiten
kann. Auch beim Trennungsunterhalt ist die Verweisung auf den Stamm
des Vermögens nicht von vornherein ausgeschlossen. Allerdings unterliegt
die Verweisung auf die Substanz des Vermögens Einschränkungen. Im
Bereich des Geschiedenenunterhalts enthält das Gesetz für den
Berechtigten in § 1577 Abs. 3 BGB - wie auch für den Verpflichteten in
§ 1581 Satz 2 BGB - die Vorschrift, dass der Vermögensstamm
nicht verwertet zu werden braucht, soweit die Verwertung unwirtschaftlich
oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse
unbillig wäre. Das setzt zugleich eine äußerste
Grenze, bis zu der der unterhaltsberechtigte Ehegatte im Falle
des Getrenntlebens auf den Vermögensstamm
allenfalls verwiesen werden darf. |
| Kindererziehung
Für die Beantwortung der Frage, ob einen Elternteil,
der Kinder betreut, eine Erwerbsobliegenheit trifft, kommt es nach ständiger
Rechtsprechung des Senats auf die persönlichen Verhältnisse des
betreuenden Elternteils sowie auf die Umstände des Einzelfalles an. Unter
diesem Gesichtspunkt sind außer einer etwaigen früheren beruflichen Tätigkeit
der Ehefrau die Dauer der Ehe und die wirtschaftliche Lage der Parteien maßgeblich
mit zu berücksichtigen, sagt der BGH in einer grundsätzlichen
Entscheidung. Bei einem Kind zwischen
dem 11. und 15. Lebensjahr war nach altem Recht weitgehend anerkannt, dass dem betreuenden
Elternteil eine Teilzeitbeschäftigung zugemutet werden kann, die aber
nicht stets den Umfang einer Halbtagsbeschäftigung erreichen muss. Von
einem Elternteil, der mehr als ein Kind betreut, kann nach dem
Bundesgerichtshof eine Erwerbstätigkeit grundsätzlich nur in geringerem
Umfang erwartet werden, als wenn nur ein Kind zu betreuen ist. Mit anderen
Worten: Das ist eine auf viele Umstände abstellende
Einzelfallüberlegung. Neu:
Mit der Neuregelung des Unterhalts hat sich die
Wertung verändert, ab wann einem Ehegatten die Erwerbsobliegenheit wieder
zuzumuten sind. Beispielhaft sei auf die Unterhaltsrechtlichen
Leitlinien der Familiensenate des Kammergerichts (Berlin)
verwiesen. Betreut ein Ehegatte ein minderjähriges Kind, so kann von ihm
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des
Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden. Danach bestimmt sich
seine Obliegenheit zur Erwerbstätigkeit nach den Umständen des
Einzelfalles. In dem Maße, in dem eine den Belangen des Kindes
gerechtwerdende Betreuungsmöglichkeit besteht, kann von dem betreuenden
Elternteil eine Erwerbstätigkeit erwartet werden. Ein abrupter
übergangsloser Wechsel von der elterlichen Betreuung zu einer
Vollzeiterwerbstätigkeit ist hierbei nicht gefordert. Im Interesse des
Kindeswohls ist auch ein abgestufter, an den Kriterien des Gesetzes
orientierter Übergang möglich. Darüber hinaus beurteilt sich die
Obliegenheit auch unter Berücksichtigung der Gestaltung der
Kindesbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe.
Mit anderen Worten: Hier bieten sich Gelegenheiten für Familiengerichte,
ihre Sensibilität in der Mitgestaltung einfühlsamer Lebensverhältnisse
zu demonstrieren. |
| |
 Unter den noch miteinander
verheirateten Ehegatten besteht eine stärkere
personale Verantwortung füreinander als nach der Scheidung.
Daher kann in der Trennungszeit die Obliegenheit, den Stamm des Vermögens
für den eigenen Unterhalt anzugreifen, nicht weiter gehen, als wenn die
Ehe geschieden ist und jeder der ehemaligen Partner im Grundsatz
wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen soll. Ob die Verwertung des Vermögensstammes
unbillig wäre, muss jedoch schon nach dem Wortlaut der Vorschrift unter
Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse
entschieden werden. Dazu gehört neben der Prüfung, in welchem Maße den
Verpflichteten die Unterhaltsgewährung aus seinem Einkommen belastet, die
Feststellung, ob und ggf. in welcher Höhe auch er Vermögen besitzt. Unter den noch miteinander
verheirateten Ehegatten besteht eine stärkere
personale Verantwortung füreinander als nach der Scheidung.
Daher kann in der Trennungszeit die Obliegenheit, den Stamm des Vermögens
für den eigenen Unterhalt anzugreifen, nicht weiter gehen, als wenn die
Ehe geschieden ist und jeder der ehemaligen Partner im Grundsatz
wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen soll. Ob die Verwertung des Vermögensstammes
unbillig wäre, muss jedoch schon nach dem Wortlaut der Vorschrift unter
Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse
entschieden werden. Dazu gehört neben der Prüfung, in welchem Maße den
Verpflichteten die Unterhaltsgewährung aus seinem Einkommen belastet, die
Feststellung, ob und ggf. in welcher Höhe auch er Vermögen besitzt.
Sofern eine Verweisung auf den Vermögensstamm
in Betracht kommt, stellt sich etwa die Frage, ob eine Berechtigte z.B.
ihr Sparguthaben vollständig aufbrauchen muss. Weil etwa eine Hausfrau im
Gegensatz zu dem Ehemann keine laufenden Erwerbseinkünfte erzielt, ist
ihr zumindest eine Vermögensreserve als "Notgroschen" für Fälle
plötzlich auftretenden (Sonder-)Bedarfs zu belassen. Ein
Miteigentumsanteil an dem Einfamilienhaus macht eine solche Rücklage
nicht entbehrlich. Er ist erfahrungsgemäß nur unter Schwierigkeiten,
daher nicht kurzfristig und häufig nur unwirtschaftlich zu verwerten;
zudem würde seine Verwertung die Möglichkeit des mietfreien Wohnens
nehmen. Wenn es aber während der Ehe auch schon eine solche Praxis der
Verwertung gegeben hat, kann das auch gerichtlich anders gesehen
werden. Vielleicht
mehr als jede andere Rechtsmaterie ist das Ehe- und Familienrecht für
Mandanten eine existenzielle Frage. Insbesondere die Verquickung von drängenden
Rechtsfragen und oft schwerer emotionaler Betroffenheit bereitet hier
Mandanten besondere Probleme, die wir helfen zu lösen, indem wir beiden
Aspekten Rechnung tragen.
|

Wir
vertreten seit Anbeginn unserer Kanzleitätigkeit zahlreiche Mandanten auf
den diversen Gebieten des Ehe- und Familienrechts: Scheidungen,
Trennung, Lebenspartnerschaften, Lebensgemeinschaften,
Härtefall, Unterhalt
nebst Auskunftsanspruch, Versorgungsausgleich,
Sorgerecht, Umgangsregelungen,
Zugewinn, Schulden,
Hausrat,
Zuweisung der Ehewohnung, Grundstücken, Scheinehe,
Eheaufhebung. Auch familienrechtliche
Konstellationen aus dem internationalen
Privatrecht, wenn also Bezüge zu fremden Rechtsordnungen, etwa europäischen
oder türkischen (Speziell
zur Scheidung nach türkischem Recht) Regelungen
zu klären waren, haben wir untersucht.
|
Top   |
|